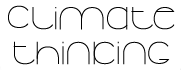Benutzer: Sina Reese/Werkstatt
| Dieser Beitrag ist kein inhaltlicher Bestandteil des Living Handbooks, sondern die persönliche Werkstatt-Seite von Nutzer*in Sina Reese. Bitte nehmen Sie keine Änderungen an dieser Seite vor, ohne dies zuvor mit Sina Reese abgesprochen zu haben. |
Der Fluch der Bananen: Extraktivismus in Lateinamerika
Lateinamerika ist ein vom Kolonialismus geprägter Kontinent, seine Auswirkungen blieben nicht folgenlos. Die aus dem Kolonialismus heraus entstandene Praxis, Naturgüter zu ext-rahieren und im Industrieland weiterzuverarbeiten, um daraus Profit zu schlagen, kennen wir heute unter dem Namen „Extraktivismus“. Inwiefern wird diese Praxis heute noch auf-rechterhalten und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Dazu wird im ersten Teil eine Übersicht über historisch gewachsene wirtschaftliche Struk-turen dargeboten. Mit einem Blick auf die Bananenplantagen in Ecuador sollen zusammen-hänge zwischen Kolonialismus und Extraktivismus erörtert werden.
Extraktivismus und Neo-Extraktivismus Die Wurzeln des Extraktivismus sind auf den Kolonialismus zurückzuführen, der vor über 500 Jahren mit der Eroberung Amerikas, Afrikas und Asiens begann. Grundvorausset-zung dafür war die Primärgüterakkumulation im kapitalistischen Wirtschaftssystem [1] .Durch den Import von ausländischen Rohstoffen konnten die Industrieländer Kapital, Macht und technologisches Wissen akkumulieren. Mittels der De-pendenztheorie, die besagt, dass Unterentwicklung keine Folge von mangelnder Integrati-on in die moderne Welt ist, sondern eine Konsequenz der spezifischen Einbindung des Entwicklungslandes in den kapitalistischen Weltmarkt (vgl. Bachinger & Matis 2009, S. 124) lässt sich die asymmetrische Arbeitsteilung erklären. Der zeitgenössische Begriff des Neo-Extraktivismus hebt sich insofern ab, als dass lateinamerikanische Regierungen, sei-en sie progressiv oder neoliberal, eine aktive Rolle beim Ressourcen-Extraktivismus ein-nehmen und durch dessen Export große Gewinne erwirtschaften, um dadurch die Ent-wicklung zu fördern (vgl. Svampa 2020, S. 14) denn daraus ergab sich eine wirtschaftli-che, gesellschaftliche und politische Stabilität in Lateinamerika. Progressive Regierungen legitimieren den Extraktivismus, da ein Umverteilungsprozess angekurbelt wird und der Konsum innerhalb der Gesellschaft zunimmt (vgl. Acosta & Brand 2018, 30). Er ist zur Grundlage der Akkumulation von Wirtschaft und Kapital des 21. Jahrhundert geworden. Die entstehenden Verteilungsspielräume im sozialen Bereich und der Kampf gegen Hunger und Armut werden von der wachsenden Mittelschicht Lateinamerikas begrüßt, da eine dem Beispiel des globalen Nordens folgende imperiale Lebensweise angestrebt wird (vgl. Acosta & Brand 2018, S. 24). Folglich führen die gegebenen Strukturen des Extraktivismus und die Abhängigkeit Lateinamerikas von transnationalen Konzernen zu einer Entfremdung und Vermarktung der Natur (vgl. Acosta & Brand 2018, S. 42; Weiterführend: Streitz, Ame-lie (2022): Werkstatt. In: Böhm, Felix; Böhnert, Martin; Reszke, Paul (Hrsg.): Climate Thin-king – Ein Living Handbook. Kassel: Universität Kassel. URL=https://wiki.climate-thinking.de/index.php?title=Benutzer:Amelie Streitz/Werkstatt, zuletzt abgerufen am 07.05.2022.) sowie der Entdemokratisierung der Bevölkerung und der Missachtung der Menschenrechte. Extraktivismus steht im Kontrast zwischen hoher Rentabilität und hohem Verlust an Menschenleben sowie der Degradation von Landstrichen (vgl. Svampa 2020, S. 13). Ein Festhalten an einer auf Extraktivismus basierenden Wirtschaftsweise schadet der Natur und zerstört wichtige Ökosysteme. Es kommt zu territorialer Transformation und Neuordnung von Landschaften (vgl.Acosta & Brand 2018, S. 126) dessen Folge die Ent-demokratisierung der Natur und des sozialen Lebens bedeutet, wie beispielsweise im Fall der Yasuní-ITT- Initiative in Ecuador (Siehe: Hernández Rentería, P. E. (2020). La iniciati-va Yasuní-ITT: una oscura lección sobre ética y desarrollo. In: Revista de la Facultad de Jurisprudencia (RFJ) Quinto: Pontifica Universidad Católica del Ecuador (7/2020). Acosta und Brand postulieren, dass Extraktivismus kein zukunftsfähiges Wirtschaftsmodell ist, da alle Ressourcen endlich sind. Es kann auch keinen positiven Extraktivismus geben, da er der Logik des Kapitalismus unterliegt und folglich des Marktes, wonach sich Armut und Reichtum ungerecht verteilen und die Gesellschaft in allen Lebensbereichen strukturiert (vgl. Acosta & Brand 2018, S. 44).
Lateinamerika und der Fluch der Bananen Neben Erdöl sind Bananen das wichtigste Exportgut Ecuadors. Man kann sagen, dass Bananen hier „das Land regieren“ (vgl. Welt und Handel). Die Landschaft im Süden ist ge-prägt von einer Monokultur durch Bananenplantagen. Sie machen ca. 75% des Marktes aus und für ihre Fläche wurde ein großer Teil des Regenwaldes zerstört. Monokulturen haben zur Folge, dass sich Schädlinge weiter ausbreiten können, was den Einsatz von Pestiziden erfordert (ebd.). Die Human Rights Watch Organisation berichtet zudem über die fatalen Arbeitsbedingungen von Kindern und Erwachsenen, die auf den Plantagen ar-beiten. So fanden sie in einer Untersuchung heraus, dass Kinder bereits ab einem Alter von 8 Jahren auf den Plantagen arbeiten und lebensbedrohlichen Umständen ausgesetzt sind (vgl. Human Rights Watch 2002). Die Arbeitszeiten auf den Plantagen sind men-schenunwürdig. So arbeiten auch Kinder für insgesamt 3,50 Dollar 12 Stunden am Tag und müssen die Schule in der Regel abbrechen. Des Weiteren wird davon berichtet, dass die Arbeiter*innen keine Gewerkschaften gründen können, da sie sonst eine Entlassung fürchten müssen, was sie nicht riskieren können. Die Hauptabnehmer der Bananen sind Chiquita, Dole, Del Monte und Noboa (ebd.), die dem US-amerikanischen Unternehmen „United Fruit Company“ (UFC, UFCO) angehören, dessen Geschäfte auf neokolonialer Ausbeutung in Süd- und Zentralamerika ab 1899 zurückzuführen sind (vgl. Chapman 2007, S. 7). Der Anbau von Bananen begann mit einigen kleinen Plantagen am Rande der Zugstrecke in Costa Rica, die aus pragmatischen Gründen gebaut werden sollte, um Han-delswege zwischen Amerika, Europa und Zentralamerika zu vereinfachen (ebd. S. 26). Zu Beginn waren exportierte Bananen ein Luxusgut, das sich wenige leisten konnten. Bana-nen sind fragile Pflanzen, die in einem tropisch-schwülen Klima am besten wachsen. Daher ist Zentralamerika ein geeigneter Anbauort (ebd. S. 13). Der Handel mit der exotischen Frucht war lukrativ. Die UFC kaufte große Anbauflächen und pflanzte Bananen auf großen Plantagen für deren Massenproduktion an. Das Monopol der UFC übt seither politischen Druck auf Regierungen aus. Die US-amerikanische Regierung intervenierte militärisch, beispielsweise bei Aufständen auf den Plantagen und unterstütze diktatorische Regime, um den ökonomischen Erfolg von UFC zu sichern (vgl. Hendricks 2021, S. 218). Ein Bei-spiel aus Guatemala im Jahr 1954 verdeutlicht seine Macht. Das Unternehmen sah sich durch den demokratischen Präsidenten Jacob Árbenz gefährdet, da er potenzielles Land für Plantagen nicht für die UFC freigeben wollte. Die UFC wendete sich an die US-amerikanische Regierung, woraufhin John Foster Dulles, ehemaliger Chef der CIA und ehemaliger Geschäftsmann bei UFC, den Sturz des Präsidenten veranlasste. Der Diktator Carlos Castillo Armas wurde mit Unterstützung der US-amerikanischen Regierung ins Amt gehoben, da er die ökonomischen Interessen der UFC sicherte. Ein 36 Jahre andauernder Bürgerkrieg folgte. Der Extraktivistismus in der Agrarwirtschaft durch die Bananenplantagen zeigt die Zerstö-rung der Natur auch deutlich menschenrechtliche Folgen für die Arbeitsbedingungen und die Machtlosigkeit der Arbeitenden auf den Plantagen. Die imperiale Geschichte Latein-amerikas zeigt deutlich, wie sich westliche Unternehmer*innen über Menschenrechte hin-wegsetzen und die Natur zwecks Profites vermarkten und zerstören. Unternehmen wie die UFC verschaffen sich durch ihren ökonomischen und politischen Einfluss steuerliche Vorteile und Landbesitz was zu einer Entdemokratisierung führt. Dies blieb auch aus litera-rischer Sicht nicht unkommentiert und so schrieb Miguel Ángel Asturias den Roman „El Papa Verde“ im Jahr 1954 und erhielt dafür den Nobelpreis für Literatur (vgl. Chapman 2007, S. 9). In einer postkolonialen Literaturanalyse soll „El Papa Verde“ genauer auf seine Kritik gegenüber dem neokolonialen und extraktivistischen Gehalt untersucht werden. Der Roman wurde der Roman ausgewählt, da er als Reaktion auf realpolitische Ereignisse aus der Perspektive eines guatemaltekischen Autors geschrieben wurde und eine nicht-westliche, kritische Stimme einnimmt.
Belege
- ↑ Radikale Alternativen. Warum man den Kapitalismus nur mit vereinten Kräften überwinden kann.. In: Urlich Brand, Alberto Acosta (Hrsg.): München: oekom Verlag, S. 32.